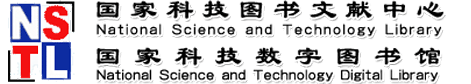

|
Die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes von Halbleitern
作者: J. H. Gisolf,
期刊:
Annalen der Physik
(WILEY Available online 1947)
页码: 3-26
ISSN:0003-3804
年代: 1947
DOI:10.1002/andp.19474360103
出版商: WILEY‐VCH Verlag
数据来源: WILEY
摘要: AbstractDas Wilson‐Guddensche Modell des Störstellenhalbleiters ist bisher ausschließlich angewandt worden unter der Annahme, daß es beim absoluten Nullpunkt der Temperatur weder Leitungselektronen noch Leitungslöcher gibt. Es wird in dieser Arbeit die Annahme gemacht, daß die durch die stöchiometrischen Abweichungen bedingten Störstellen in der Regel Elektronenspender sind, deren Energieniveau oberhalb des unteren Randes des Leitungsbandes liegt, oder Elektronenfänger sind, deren Energieniveau unterhalb des oberen Randes des höchsten vollen Bandes liegt. Es wird gezeigt, daß diese Spender bzw. Fänger praktisch immer vollständig ionisiert sind. Dadurch ist der Energiewert dieser Niveaus für die Erscheinungen vollkommen gleichgültig. Es werden Formeln hergeleitet für den Fall, daß neben diesen thermisch inaktiven Spendern oder Fängern auch thermisch aktive Spender oder Fänger vorhanden sind, so wie sie bisher ausschließlich in Betracht gezogen worden sind. Anstatt der linearen Beziehung zwischen log σ und 1/Tfindet man jetzt einen komplizierten Verlauf, der in vielen Fällen die vielgestaltigen Beobachtungen wiederzugeben vermag. Zur Erklärung der Meyerschen Regel wird angenommen, daß sich unterhalb des Leitungsbandes des Halbleiters ein Kontinuum von Haftstellen anschließt. Die elektronenspendenden Störstellen liegen, wie gesagt, als Regel oberhalb des unteren Randes des Leitungsbandes und sind völlig dissoziiert.Damit die Meyersche Regel gilt, muß die Dichte des Haftstellenspektrums so groß sein, daß das thermische Potentialgder Elektronen praktisch temperaturunabhängig ist. In diesem Fall hat die Meyersche Gerade die Neigungk T.Es zeigt sich, daß dieser Wert eine ausgezeichnete Annäherung darstellt. Die beobachteten Werte sind größer alsk T.Der Koeffizientain der Leitfähigkeitsformel: σ =aexp ‐ϵ/k Tsoll in diesem Fall gleichu e(2 μm k T/h2)3/2sein. Setzt man die Zahlenwerte ein, so bekommt man fürT= Raumtemperatur:a= 4,1u.Diese Beziehung ist qualitativ und größenordnungsmäßig in Übereinstimmung mit den vorliegenden Beobachtungen. Die abweichenden Neigungen der Meyerschen Geraden lassen sich formell immerauf eine Beziehung zwischen der Beweglichkeituund der Leitfähigkeit σ der Formu=Aω−Bzurückführen. Für ein homogenes Haftstellenspektrum würde aus der Gültigkeit der Meyerschen Regel folgen, daß\documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$ u = c_1 \exp - c_2 N_2 \left({C_2>O} \right) $\end{document}, wenn die Neigung der Geraden>k Tist. Qualitativ gibt diese Formel die Tatsachen richtig wieder. Das Beobachtungsmaterial gestattet keinen genauen Vergleich. Das Modell, das der Erklärung der Meyerschen Regel zugrunde gelegt ist, macht es verständlich, wie sich durch relativ geringfügige Änderung der Zusammensetzung die Leitfähigkeit um mehrere Zehnerpotenzen ändern kann. Ob eine Verbindung einen positiven oder einen negativen Temperaturkoeffizient der Leitfähigkeit hat, hängt von der Differenz der Haftstellen‐ und der Störstellenkonzentration ab. Für das typische Halbleiterverhalten muß die Haftstellenkonzentration größer als die Konzentration der stöchiometrisch bedingten Störstellen sein.Die stöchiometrischen Abweichungen, die in den Verbindungen auftreten können, unterscheiden sich für die verschiedensten Verbindungen um mehrere Zehnerpotenzen. Besonders groß sind sie bei den mehrwertigen Metalloxyden, ‐sulfiden und ‐seleniden. Diese Stoffe zeigen eine “metallische” Leitfähigkeit, sofern nicht durch besondere Umstände die Haftstellenkonzentration, die bei diesen Stoffen anscheinend fast immer kleiner als die Störstellenkonzentration ist, genügend groß wird, um den Temperaturkoeffizientder Leitfähigkeit positiv machen zu können. Anscheinend tritt dies ein bei dünnen Schichten (von PbS und PbSe), die durch Aufdampfen oder durch Verspiegelung hergestellt sind. Die von Hinterberger an derartigen Schichten beobachtete Temperatur
点击下载:
|
|
版权所有 © 2009 NSTL国家科技图书文献中心 咨询热线:800-990-8900 010-58882057 Email:service@nstl.gov.cn 地址:北京市复兴路15号 100038 京ICP备05017586号 |
 首页
首页
 PDF
PDF